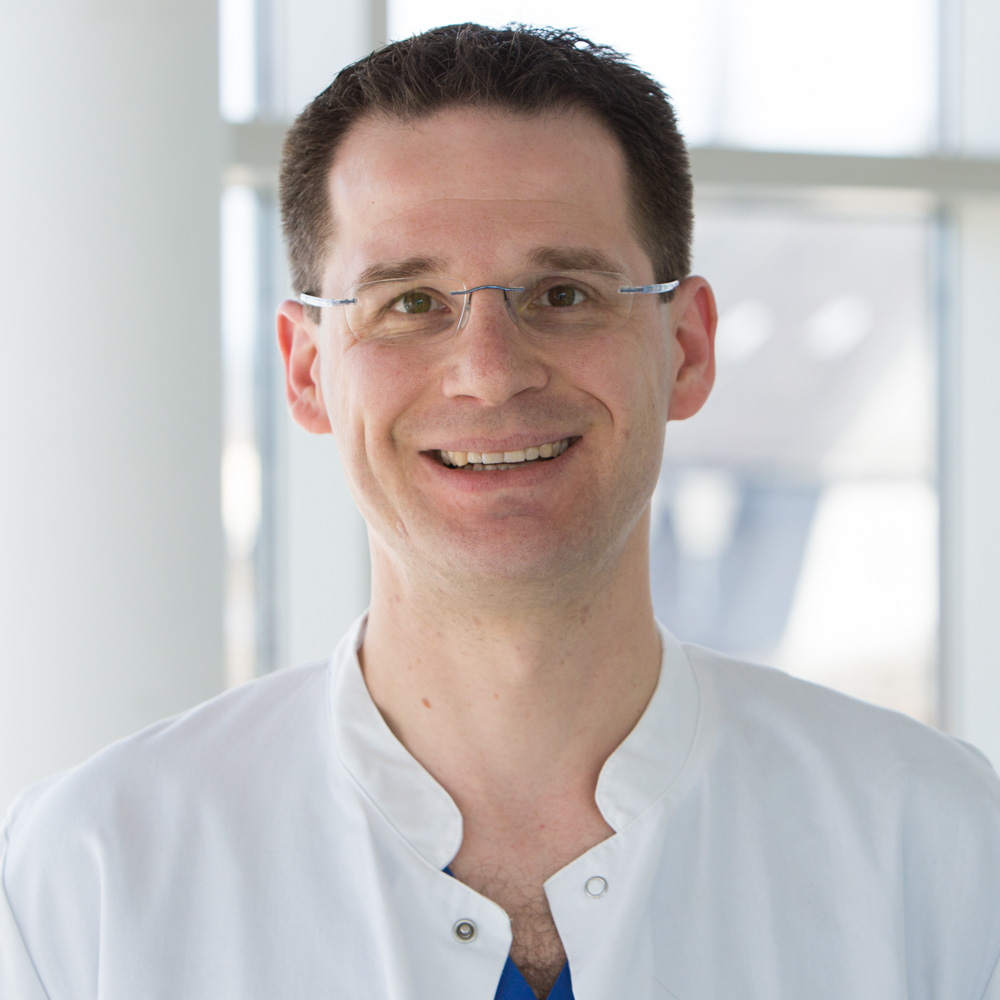Angiologie
|
|
Ansprechpartner: E-mail: pascal.bauer@innere.med.uni-giessen.de
|
Willkommen in der Angiologischen Abteilung des Universitätsklinikums Gießen
In der angiologischen Abteilung des Universitätsklinikums Gießen widmen wir uns der Diagnostik, Therapie und Prävention von Erkrankungen der arteriellen und venösen Gefäße. Als Teil eines universitären Maximalversorgers verbinden wir modernste medizinische Technik mit interdisziplinärer Expertise und individueller Patientenbetreuung.
Unser Team aus spezialisierten Ärztinnen und Ärzten und Pflegefachkräften bietet das gesamte Spektrum angiologischer Leistungen – von der Abklärung unklarer Durchblutungsstörungen bis zur Behandlung komplexer Gefäßerkrankungen wie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK), Thrombosen oder Venenleiden.
Dank unserer engen Zusammenarbeit mit den Bereichen Kardiologie, Gefäßchirurgie, Radiologie und Diabetologie stellen wir eine umfassende, patientenzentrierte Versorgung sicher – nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und höchsten klinischen Standards.
Unser Ziel ist es, die Lebensqualität unserer Patientinnen und Patienten zu erhalten oder wiederherzustellen – mit Präzision, Empathie und wissenschaftlichem Anspruch.
Krankheitsbilder
Angiologische Krankheitsbilder betreffen die Blutgefäße des Körpers – also Arterien, Venen und Lymphgefäße – und gehören zu den häufigsten internistischen Erkrankungen. Sie reichen von arteriellen Durchblutungsstörungen über Venenerkrankungen bis hin zu Schwellungen und Stauungen des Lymphsystems. Diese Erkrankungen können sowohl lokal begrenzte Beschwerden verursachen als auch systemische Auswirkungen auf die Organdurchblutung und damit auf die allgemeine Gesundheit haben.
Zu den häufigsten angiologischen Krankheitsbildern zählen unter anderem die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), venöse Thrombosen, Krampfadern (Varikosis), chronisch-venöse Insuffizienz sowie Lymphödeme. Viele dieser Erkrankungen entwickeln sich schleichend und bleiben lange unbemerkt – unbehandelt können sie jedoch zu schwerwiegenden Komplikationen führen, etwa offenen Beinen, Embolien oder Amputationen.
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK): ist eine chronisch-progrediente arterielle Durchblutungsstörung der Extremitäten, meist infolge atherosklerotischer Veränderungen der Beinarterien. Klinisch manifestiert sie sich typischerweise durch belastungsabhängige Schmerzen der Muskulatur (Claudicatio intermittens) – bevorzugt in der Wadenregion – und kann in fortgeschrittenen Stadien zur kritischen Extremitätenischämie mit Ruheschmerz, Ulzerationen oder Gangrän führen. Risikofaktoren umfassen insbesondere Nikotinkonsum, Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie und Hyperlipidämie. Die pAVK gilt zudem als Marker für eine generalisierte Atherosklerose und ist häufig mit kardiovaskulären und zerebrovaskulären Erkrankungen assoziiert.
Die Diagnostik umfasst neben der klinischen Untersuchung die Messung des Knöchel-Arm-Index (ABI), Farbduplexsonografie sowie gegebenenfalls weiterführende bildgebende Verfahren wie CT- oder MR-Angiografie. Therapeutisch kommen je nach Schweregrad konservative Maßnahmen (Risikofaktormanagement, Gehtraining, medikamentöse Therapie), interventionelle Verfahren (Ballonangioplastie, Stentimplantation) oder chirurgische Revaskularisationstechniken zum Einsatz. - Cerebrale arterielle Verschlusskrankheit (cAVK): beschreibt die Verengung oder den Verschluss hirnversorgender Arterien in der Regel durch arteriosklerotische Prozesse. Sie stellt eine wesentliche Ursache transitorisch ischämischer Attacken (TIA) und ischämischer Schlaganfälle dar und ist mit einer hohen Morbidität und Mortalität verbunden. Risikofaktoren entsprechen denen der systemischen Atherosklerose: arterielle Hypertonie, Dyslipidämie, Diabetes mellitus, Nikotinabusus und ein erhöhtes Alter. Klinisch äußert sich die Erkrankung durch fokal-neurologische Defizite, die je nach betroffener Gefäßregion variieren.
Die Diagnostik umfasst Duplexsonografie der extrakraniellen Hirnarterien, transkranielle Dopplersonografie sowie CT- oder MR-Angiografie zur Darstellung intrakranieller Gefäßveränderungen. Therapeutisch stehen – je nach Stenosegrad und Symptomatik – medikamentöse Sekundärprävention (Thrombozytenaggregationshemmung, Statine, Blutdruckeinstellung), endovaskuläre Verfahren (z. B. Stenting) oder chirurgische Interventionen wie die Karotisendarteriektomie zur Verfügung. - Venöse Thromben: entstehen durch intravasale Gerinnselbildung, typischerweise in den tiefen Bein- oder Beckenvenen (tiefe Venenthrombose, TVT) und können zu relevanten hämodynamischen und embolischen Komplikationen führen, insbesondere zur Lungenembolie. Aus angiologischer Sicht stehen neben der akuten Diagnostik (Kompressionssonografie, Duplexsonografie, ggf. Phlebografie) insbesondere die differenzierte Stadienklassifikation, Risikostratifizierung und individuelle Therapieplanung im Vordergrund. Langfristig ist die Prävention postthrombotischer Komplikationen essenziell. Hierzu zählen Kompressionstherapie, Verlaufskontrollen sowie das Management begleitender Risikofaktoren wie Immobilität, Tumorerkrankungen oder Thrombophilien.
Untersuchungstechniken
Die angiologische Abteilung des Universitätsklinikums Gießen bietet ein umfassendes Spektrum moderner, nicht-invasiver und invasiver Gefäßdiagnostik zur präzisen Beurteilung arterieller und venöser Erkrankungen.
Folgendes Leistungsangebot steht Ihnen bei uns zur Verfügung:
- Carotis-Doppler-Sonographie: ist eine nicht-invasive, bildgebende Standardmethode zur Beurteilung der extrakraniellen hirnversorgenden Arterien. Sie ermöglicht die gleichzeitige morphologische und hämodynamische Bewertung von Gefäßwandveränderungen, Stenosen und Plaquemorphologie. Die Untersuchung erfolgt in Rückenlage mit leicht überstrecktem und zur Gegenseite rotiertem Kopf. Mittels B-Bild-Sonographie (graustufenbasiert) werden Gefäßverlauf, Wandstruktur und Plaques visualisiert. Im Anschluss erfolgt die Farbdoppler- und pulsed-wave-Doppler-Sonographie zur hämodynamischen Analyse. Dabei werden Flussrichtungen, Strömungsprofile und maximale systolische sowie enddiastolische Flussgeschwindigkeiten gemessen, anhand derer sich der Stenosegrad nach etablierten Kriterien (z. B. NASCET) quantifizieren lässt. Neben der Stenosequantifizierung erlaubt die Carotis-Duplexsonographie auch die Detektion von hochrisikoreichen Plaques (z. B. echoarmen, ulzerierten oder instabilen Plaques) und ist essenziell zur Risikostratifizierung bei asymptomatischen sowie symptomatischen Patienten. Die Untersuchung ist wiederholbar, strahlungsfrei und spielt eine zentrale Rolle im Screening, in der Schlaganfallprävention und bei der Verlaufskontrolle nach Revaskularisation.
- Nierenarterien-Doppler-Sonographie: dient primär der Diagnose und Verlaufskontrolle von Stenosen (Gefäßverengungen), die häufig durch arteriosklerotische Prozesse oder fibromuskuläre Dysplasien bedingt sind. Die Untersuchung erfolgt mittels farbcodierter Duplexsonographie, bei der sowohl morphologische als auch hämodynamische Parameter erfasst werden. Die Untersuchung erfolgt transabdominal mit einem konvexen Schallkopf (2–5 MHz), meist in Rückenlage. Eine gute Atemkoordination des Patienten ist entscheidend, da die Nierenarterien durch die Atemlage beeinflusst werden.
- Sonographie der peripheren Arterien: ist ein zentrales diagnostisches Verfahren zur Beurteilung arterieller Durchblutungsstörungen, wie sie bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) auftreten. Die Untersuchung ermöglicht die Darstellung von Gefäßmorphologie und Blutfluss in Echtzeit und erfolgt segmentweise entlang der Extremitätenarterien.
-
Sonographie der peripheren Venen: ist die Methode der Wahl zur Diagnostik venöser Erkrankungen, insbesondere zur Erkennung und Beurteilung tiefer Venenthrombosen (TVT) und chronisch-venöser Insuffizienz. Sie kombiniert B-Bild-Sonographie zur morphologischen Beurteilung der Venenwand und des Lumens mit der Farbdoppler- und pulsed-wave-Doppler-Technik zur Analyse des venösen Blutflusses. Der Patient wird meist in flacher Rückenlage oder leicht erhöht gelagert untersucht, um eine optimale Darstellung der tiefen und oberflächlichen Venensysteme der unteren Extremitäten zu gewährleisten. Mittels Kompressionstest werden Venenabschnitte auf Komprimierbarkeit überprüft – ein fehlendes Kollabieren spricht für eine Thrombose. Farbdoppler zeigt Flussrichtung und mögliche Stase. Pulsed-wave-Doppler ermöglicht die Messung der Flussgeschwindigkeit und -qualität, was zur Diagnostik einer refluxiven Insuffizienz oder Okklusion dient. Die venöse Duplexsonographie ist schmerzfrei, strahlenfrei und wiederholbar. Sie stellt den Goldstandard in der venösen Gefäßdiagnostik dar und ist unverzichtbar für die Therapieplanung und Verlaufsbeurteilung bei thrombotischen sowie insuffizienten Venenerkrankungen.
-
Kapillarmikroskopie: ist ein nicht-invasives bildgebendes Verfahren zur direkten Darstellung der Kapillaren, meist an der Nagelbettregion der Finger. Sie ermöglicht die Beurteilung der Morphologie und Funktion der kleinsten Blutgefäße (Mikrozirkulation) und ist insbesondere bei der Diagnostik und Verlaufskontrolle von vaskulären und systemischen Erkrankungen wie systemischer Sklerose oder anderen Kollagenosen von großer Bedeutung. In der Angiologie dient die Kapillarmikroskopie zur Erkennung mikroangiopathischer Veränderungen, die frühzeitig Hinweise auf Gefäßbeteiligung geben können, bevor makrovaskuläre Läsionen auftreten. Das Verfahren ist schmerzfrei, einfach durchführbar und ergänzt andere angiologische Diagnostikmethoden durch seine spezifische Information zur Mikrozirkulation.
-
Oszillographie: ist ein nicht-invasives diagnostisches Verfahren zur Beurteilung der arteriellen Durchblutung in den Extremitäten. Dabei werden Druckschwankungen an den Gliedmaßen erfasst, die durch den pulsierenden Blutfluss verursacht werden. Aus den aufgezeichneten Oszillationen lassen sich Rückschlüsse auf die Gefäßelastizität, den Gefäßwiderstand sowie den Schweregrad arterieller Verschlusskrankheiten ziehen. In der Angiologie wird die Oszillographie vor allem zur Ergänzung anderer Untersuchungen wie dem Knöchel-Arm-Index (ABI) und der Dopplersonographie eingesetzt. Sie ermöglicht eine einfache, schmerzfreie und schnelle Einschätzung der peripheren arteriellen Zirkulation und unterstützt die Früherkennung sowie Verlaufskontrolle von Gefäßerkrankungen.
-
Verschlussplethysmographie, Venenverschlussplethysmographie: ist ein nicht-invasives Verfahren zur Messung des Blutflusses und der Gefäßfunktion in den Extremitäten. Dabei wird durch temporäres Abklemmen der Venen der Blutzufluss in die untersuchte Körperregion bestimmt und Rückschlüsse auf die arterielle Durchblutung und die Gefäßelastizität gezogen. Die Venenverschlussplethysmographie konzentriert sich speziell auf die venöse Funktion. Hierbei wird eine Manschette am Oberschenkel oder Oberarm aufgeblasen, um den venösen Rückfluss zu unterbrechen, während gleichzeitig das Volumen der Extremität gemessen wird. So lassen sich venöse Refluxzustände, Venenklappeninsuffizienzen sowie die venöse Kapazität und Compliance beurteilen. Beide Verfahren ergänzen die angiologische Diagnostik, insbesondere bei der Differenzierung arterieller und venöser Durchblutungsstörungen, und liefern wichtige Informationen für die Therapieplanung und Verlaufskontrolle.